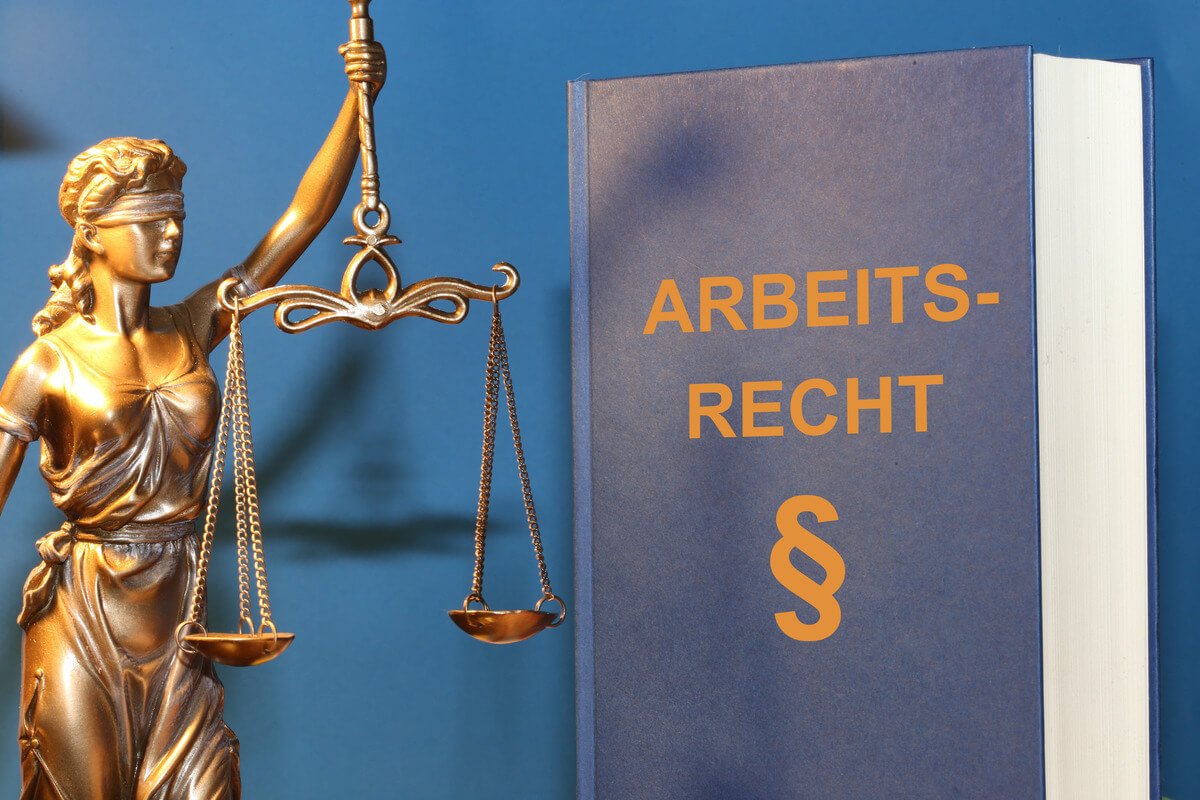Eine Kündigung kann überraschend kommen und erheblichen Druck erzeugen. Arbeitnehmer müssen oft schnell entscheiden, ob sie Kündigungsschutzklage einlegen – die Frist beträgt nur 3 Wochen. Verpasst man sie, gilt die Kündigung als wirksam. Dabei spielen auch die Kosten der Klage, besonders ohne Rechtsschutzversicherung, eine große Rolle. Unser Artikel erklärt, welche Kosten auf Arbeitnehmer zukommen und wie man Chancen und Risiken einer Klage abwägen sollte.
Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden für kostenlose Erstberatung mit Anwalt
Das Wichtigste in Kürze
- Arbeitnehmer haben vor den meist arbeitnehmerfreundlichen Arbeitsgerichten im Einzelfall gute Chancen, sich mit einer Kündigungsschutzklage erfolgreich gegen eine Kündigung zu wehren und eine faire Abfindung zu erreichen.
- Die Kündigungsschutzklage kostet aber Geld – für Rechtsanwalt und Gericht. Basis für Gerichts- und Anwaltskosten ist der Streitwert, der bei Kündigungsschutzklagen in der Regel dem Dreifachen des monatlichen Bruttogehalts entspricht.
- Die genauen Kosten für “Ihren“ Fall können Sie unseren Tabellen und dem Kostenrechner für Kündigungsschutzklagen (unten) entnehmen.
- Zur Minderung der finanziellen Belastung gibt es Rechtsschutzversicherung und Prozesskostenhilfe, die aber nicht jeder in Anspruch nehmen kann. Daher sollte man mit einem Rechtsanwalt offen über Chancen und Kosten einer Kündigungsschutzklage sprechen und diese gegeneinander abwägen.
Inhalte
Was ist eine Kündigungsschutzklage
Eine Kündigungsschutzklage ist ein Gerichtsverfahren, bei dem ein Arbeitnehmer die Wirksamkeit einer Kündigung überprüfen lässt. Sie kommt vor allem in Betracht, wenn der Arbeitnehmer die Unwirksamkeit der Kündigung für wahrscheinlich hält – oder das zumindest geltend macht. Gründe für die Unwirksamkeit können fehlende Kündigungsgründe, die Nichterfüllung von Kündigungsfristen, oder Formfehler sein. Die Verfahren gehen meist relativ schnell und gehen oft zu Gunsten des Arbeitnehmers aus:
- Abhängig vom zuständigen Arbeitsgericht wird ein Kündigungsschutzverfahren meist innerhalb von ein bis drei Monaten abgeschlossen.
- Arbeitnehmer haben dabei vor den – i.d.R. arbeitnehmerfreundlichen – Arbeitsgerichten häufig gute Chancen, sich erfolgreich gegen eine Kündigung zu wehren und eine faire Abfindung zu erreichen. Das hängt aber natürlich vom individuellen Fall ab.
Problem: Die 3-Wochen-Frist
Einen wichtigen „Haken“ gibt es aber bei der Kündigungsschutzklage: Die Klage muss innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt der Kündigung beim Arbeitsgericht eingehen. Nach Erhalt einer Kündigung bleibt Arbeitnehmern nur wenig Zeit, um eine wichtige Entscheidung zu treffen: Sollen sie sich gerichtlich gegen die Kündigung wehren oder ein bereits vorliegendes Abfindungsangebot annehmen? Denn das Arbeitsgericht muss innerhalb der oben genannten Drei-Wochen-Frist angerufen werden. Wird diese Frist versäumt, gilt die Kündigung als wirksam – selbst dann, wenn sie unwirksam oder rechtlich angreifbar gewesen wäre.
Aspekte der Kosten/Nutzen-Abwägung einer Klage
Als Arbeitnehmer muss man daher in kürzester Zeit entscheiden, ob man sich mit einer Kündigungsschutzklage gegen die Kündigung wehren will. Dazu muss man Kosten und Chancen (z. B. auf eine höhere Abfindung) für alle möglichen Vorgehensweisen miteinander vergleichen. Die möglichen Vorgehensweisen sind aus Sicht des Arbeitnehmers meistens:
- Klage einzureichen (i.d.R. mit parallelen Verhandlungen mit dem Arbeitgeber)
- Verhandlungen über eine Abfindung einzuleiten und innerhalb der Klagefrist von drei Wochen abzuschließen,
- ein bereits vorliegendes Abfindungsangebot anzunehmen oder innerhalb der Klagefrist von drei Wochen nachzuverhandeln
- Wenn kein Angebot vorliegt, auf seine Ansprüche ganz zu verzichten und nichts gegen die Kündigung zu unternehmen.
Vereinfacht gesagt entscheidet sich die Frage danach, wie hoch die zusätzlich erzielbare Abfindung ist und welche Kosten mit den einzelnen Optionen verbunden sind. In der Regel machen Sie diese Rechnung im Rahmen einer kostenlosen Erstberatung mit einem Rechtsanwalt auf – ein Beispiel:
Beispiel
Herr M. ist seit 01.03.2016 als Filialleiter beschäftigt (Gehalt zuletzt: 7.000 EUR, Kündigungsfrist 3 Monate). Er ist in zwei Filialen seines Arbeitgebers tätig, die aber beide weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigen. Nach einem Vorgesetztenwechsel spricht der Arbeitgeber am 28.09.24 eine Kündigung zum 31.12.2024 aus. Und zwar ohne Begründung, Sozialauswahl oder Abfindungsangebot, da der Arbeitgeber das Kündigungsschutzgesetz nicht für anwendbar hält.
Nach einer Erstberatung mit einem Anwalt legt dieser Klage ein und weist die Kündigung zurück. Im Gütetermin im Januar stellt sich heraus, dass die Kündigung schon aus formalen Gründen unwirksam war. Der Arbeitgeber kündigt zwar sofort wieder (und diesmal wirksam). Aber: Die neue Kündigung ist nur unter Einhaltung einer neuen Dreimonatsfrist, also erst zum 30.04.2025, möglich. So dass M. auf jeden Fall bis April Gehalt bekommt.
Zusätzlich trägt der Anwalt von Herrn M. vor, dass das Kündigungsschutzgesetz doch Anwendung findet. Denn die beiden Filialen bilden laut Anwalt einen „Gemeinschaftsbetrieb“1 und sind deswegen für die Berechnung der Mitarbeiterzahl zusammen zu rechnen. Der Arbeitgeber sieht das völlig anders, will aber plötzlich verhandeln. Man vergleicht sich auf eine Abfindung mit Faktor 1, also 63 TEUR (9 x 7 TEUR), Freistellung bis 30.06.2025 und “Turboklausel”.2 Die Herr M. am 01.05.2025 in Anspruch nimmt, weil er schon wieder einen neuen Job hat.
Herr M. hat also 6 Monate länger Gehalt (42 TEUR) und eine Abfindung (63 TEUR) erhalten, in Summe: 105 TEUR. Dabei ist das “doppelte” Gehalt für 2 Monate im neuen Job nicht mit eingerechnet. Demgegenüber sind Herrn M. folgende Kosten für seinen Anwalt entstanden:
- Anwaltsgebühren: 2.055,00 EUR
- Vergleichsgebühr, Auslagen: 842,00 EUR
- Netto: 2.897,00 EUR
- MwSt.: 550,43 EUR
- Gesamt: 3.447,43 EUR
Vorherige Durchsprache von Chancen und Kosten mit einem Anwalt sinnvoll
Die Entscheidung, eine Kündigungsschutzklage einzureichen, erscheint oft erst im Nachhinein einfach. Vorab ist die Lage meist unklar, daher sollten Kosten (Anwaltshonorare) und Erfolgsaussichten genau abgewogen werden. Anwälte schaffen in der Regel Transparenz, Fragen zur Klärung sind aber sinnvoll. Ohne Anwalt sind die Kosten zwar niedriger, doch erfolgreiche Verhandlungen über Abfindungen sind deutlich schwieriger.

Jetzt kostenlos Abfindung berechnen
- Potenzielle Abfindungshöhe berechnen
- Strategie zum Verhandeln einer fairen Abfindung
- Passende Anwälte für Arbeitsrecht finden
Kosten einer Kündigungsschutzklage für Arbeitnehmer
Die Kosten einer Kündigungsschutzklage bestehen aus
- Gerichtskosten und
- Anwaltskosten
Basis für beide (Gerichts- und Anwaltskosten) ist der sog. Streitwert, der bei Kündigungsschutzklagen in der Regel dem Dreifachen des monatlichen Bruttogehalts entspricht (dazu unten). In der ersten Instanz vor dem Arbeitsgericht trägt jede Partei ihre Anwaltskosten selbst, egal wer gewinnt. Gerichtskosten entstehen in der Regel nur, wenn das Verfahren durch ein Urteil und nicht durch einen Vergleich beendet wird. Im Einzelnen gilt:
Gerichtskosten
Gerichtskosten entstehen, wenn ein Urteil gefällt wird, und entfallen, sofern Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen außergerichtlichen Vergleich schließen. Bei einem Urteil bestimmen sich die Kosten anhand des Streitwerts. Dieser entspricht in der Regel drei Bruttomonatsgehältern. Beispielsweise ergibt sich bei drei Monatsgehältern von jeweils 3.000 EUR ein Streitwert von insgesamt 9.000 EUR – daraus folgt laut Tabelle eine einfache (!) Gebühr von 245 EUR. Die Gerichtskosten betragen aber ggf. auch 2 -3 Gebühren, welche von der unterlegenen Partei getragen werden müssen. In der folgenden Tabelle finden Sie einfache (!) Gerichtsgebühr in Abhängigkeit vom Streitwert (Nicht: Bruttogehalt):
| Streitwert bis (EUR)3 | Einfache Gebühr (EUR) |
|---|---|
| 6.000 | 182 |
| 7.000 | 203 |
| 8.000 | 224 |
| 9.000 | 245 |
| 10.000 | 266 |
| 13.000 | 295 |
| 16.000 | 324 |
| 19.000 | 353 |
| 22.000 | 382 |
| 25.000 | 411 |

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt
- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden
- Strategie zum Verhandeln der Abfindung
Anwaltskosten
Wenn man sich bei der Kündigungsschutzklage anwaltlich vertreten lässt, entstehen Anwaltskosten. Diese Kosten trägt man grundsätzlich selber, auch wenn man vor dem Arbeitsgericht gewinnt. Eine Ausnahme besteht natürlich, wenn die Rechtsschutzversicherung die Kosten übernimmt (dazu unten).
Kostentragung vor dem Arbeitsgericht
- Abrechnungsarten von Anwälten:
- Meistens nach RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) – „gesetzliche Gebühren“.
- Alternativ nach Stundensatz, vor allem zwischen Arbeitgebern und deren Anwälten üblich.
- Kombination beider Modelle ist selten und umstritten.
- Stundensatz ist meist nicht günstiger als RVG – daher gängige Praxis: Abrechnung nach RVG.
- Erfolgshonorare sind in Deutschland stark eingeschränkt und praktisch kaum relevant.
- Gebührenhöhe:
- Hängt vom Streitwert ab.
- Kostenverteilung im Arbeitsgerichtsverfahren:
- Erste Instanz: Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten, egal wie das Verfahren ausgeht.
- Ab der zweiten Instanz (Berufung vor dem Landesarbeitsgericht) ändert sich die Kostenregelung.
- Anwaltsvertretung:
- Dennoch ist es oft empfehlenswert, einen Anwalt einzuschalten, besonders bei der Rechtsschutzversicherung. In der ersten Instanz besteht kein Anwaltszwang.
Gebührenarten bei Anwaltskosten
Die Gebühr für den Anwalt enthält folgende Gebühren:
- Verfahrensgebühr
- Terminsgebühr
- Einigungsgebühr (optional im Falle eines Vergleichs)
Außerdem darf der Rechtsanwalt nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) noch maximal 20 € als Auslagenpauschale verlangen. Und: Als Verbraucher muss man auch Mehrwertsteuer auf die Anwaltskosten zahlen.
In der folgenden Tabelle stehen die gesamten Anwaltskosten für die Führung des Prozesses (Verfahrensgebühr) sowie für die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Mandanten (Terminsgebühr), Auslagenpauschale und Mehrwertsteuer – abhängig vom Streitwert.
| Streitwert bis (EUR)3 | Anwaltskosten |
|---|---|
| 6.000 | 1184 |
| 7.000 | 1351 |
| 8.000 | 1517 |
| 9.000 | 1684 |
| 10.000 | 1850 |
| 13.000 | 2005 |
| 16.000 | 2160 |
| 19.000 | 2315 |
| 22.000 | 2469 |
| 25.000 | 2624 |
Bei einem Vergleich steigen die Anwaltskosten aufgrund der Einigungsgebühr zwar an, allerdings entfallen dafür die Gerichtskosten – das gleicht sich dann meist (fast) aus.
Unten finden Sie auch einen Kostenrechner für Kündigungsschutzklagen, um die Kosten Anwalt (Kündigungsschutzklage) ebenso wie die Gerichtskosten (die aber meist entfallen) zu ermitteln.
Fallbeispiel
Ein kurzes Beispiel soll das erläutern: Ein Arbeitnehmer verdient monatlich 2.000 € brutto und verliert seinen Job. Er klagt gegen die Kündigung. Damit ergibt sich für Sie ein Streitwert in Höhe von 6.000 € (dreifaches Bruttomonatsgehalt).
Entscheidung durch Urteil
Wird kein Vergleich erzielt – und muss das Arbeitsgericht deshalb ein Urteil fällen – fallen einerseits Gerichtskosten (Tabelle 1) und andererseits Anwaltskosten (Tabelle 2) an. Das sind 364 € für das Gericht und 975 € für den Anwalt. Zusätzlich kann der Anwalt noch 20 € als Auslagenpauschale in Rechnung stellen. Daraus ergeben sich insgesamt 995 € für den Anwalt, wozu noch 189,05 € Mehrwertsteuer hinzukommen. Damit belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.548,05 €.
Entscheidung durch gerichtlichen Vergleich
Häufig wird aber auch vor Gericht ein Vergleich erzielt – Das ist Anwälten und Richtern meist lieber. Dann entfallen die Gerichtskosten, aber der Arbeitnehmer muss durch eine Einigungsgebühr erhöhte Anwaltskosten zahlen. Bei einem Streitwert von 6.000 € beträgt die Anwaltsgebühr 1.365 € (Tabelle 3). Auch hier kann der Anwalt wiederum 20 € als Auslagenpauschale verlangen. Insgesamt ergeben sich somit 1.385 €, wobei 263,15 € an Mehrwertsteuer hinzukommen. Damit muss mit 1.648,15 € gerechnet werden. Etwas mehr als beim Urteil.
Berechnen Sie Ihre Abfindungssumme
Jetzt in 2 min für Ihren individuellen Fall Abfindungssumme berechnen!
Rechtsschutzversicherung und Prozesskostenhilfe (PKH)
Zur Minderung der finanziellen Belastung gibt es Möglichkeiten. Dazu zählt insbesondere die Rechtsschutzversicherung (RSV). Diese übernimmt, je nach Versicherungsvertrag, die Kosten für Anwalt, Gericht und eventuell auch für Sachverständige und Zeugen. Wichtig: Wartezeiten beachten. Bei einer RSV besteht oft eine Wartezeit von 3-6 Monaten, daher ist ein rechtzeitiger Abschluss wichtig, sonst zahlt der Rechtsschutz nicht.
Dagegen stellt die Prozesskostenhilfe (PKH) eine staatliche Unterstützung für Personen dar, die sich die Kosten eines Rechtsstreits nicht leisten können. Die PKH ist abhängig vom Einkommen und Vermögen, sodass auch für finanziell schwächere Personen der Zugang zum Rechtssystem sichergestellt wird. Auch hier werden die Gerichts- und Anwaltskosten nach einem entsprechenden Antrag übernommen.
Übrigens bieten auch Gewerkschaften ihren Mitgliedern oft Rechtsschutz im Arbeitsrecht an. Dieser Rechtsschutz umfasst i.d.R. eine kostenlose Rechtsberatung und, ggf. nach einer Mitgliedschaftsdauer, u.U. auch kostenlose Prozessvertretung.
Streitwert bei Kündigungsschutzklage
Der Streitwert bei Kündigungsschutzklagen ist für Arbeitnehmer, die von einer Kündigung betroffen sind, eine wichtige Größe. Der Streitwert zeigt, “um wie viel Geld es geht” bei einem Gerichtsverfahren und bestimmt die Höhe der Gerichts- und Anwaltskosten. Nebenbei beeinflusst er auch, welches Gericht zuständig ist und ob man Rechtsmittel einlegen kann. Bei Kündigungsschutzklagen wird als Streitwert das dreifache Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmers zu Grunde gelegt („Vierteljahresgehalt“). Streitwerterhöhende Faktoren können Themen wie Weiterbeschäftigung, Zeugniserteilung oder Gehaltsnachzahlung sein. Die Höhe der Abfindung hat aber keinen Einfluss auf den Streitwert. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zum Streitwert bei Kündigungsschutzklagen.
Kostenrechner für Kündigungsschutzklagen
Unser Kostenrechner berechnet schnell und unkompliziert die voraussichtlichen Kosten einer Kündigungsschutzklage. Die Berechnung erfolgt vereinfacht und dient der ersten groben Orientierung – basierend auf dem monatlichen Bruttogehalt sowie der Frage, ob der Fall mit oder ohne Vergleich endet. In rund 80 % aller Kündigungsschutzverfahren wird ein gerichtlicher Vergleich geschlossen, wodurch keine Gerichtskosten anfallen und die Gesamtkosten in der Regel niedriger ausfallen.
Kostenrechner Kündigungsschutzklage
Berechnung nach den Gebührentabellen von RVG und GKG (angelehnt an die Berechnung des Arbeitsgerichts Hamm).

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt
- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden
- Strategie zum Verhandeln der Abfindung
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Kündigungsschutzklage: Ein Mittel gegen ungerechtfertigte Kündigungen
- Frist für eine Kündigungsschutzklage
- Streitwert bei Kündigungsschutzklage: Infos zur Berechnung des Streitwerts
- Klage auf Wiedereinstellung: So bekommen Sie Ihren alten Job zurück!
- Kündigungsschutzklage ohne Anwalt: Welche Optionen haben Arbeitnehmer
- Ein „Gemeinschaftsbetrieb“ setzt den Einsatz der Arbeitnehmer und Betriebsmittel mehrerer Unternehmen durch eine einheitliche Leitung voraus (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.05.2019 – 3 Sa 63/18). ↩︎
- Eine „Sprinterklausel“ (auch „Turboklausel“) in einem Aufhebungsvertrag ermöglicht es dem Arbeitnehmer, das Unternehmen vor dem im Aufhebungsvertrag vereinbarten Beendigungszeitpunkt zu verlassen. ↩︎
- Diese Werte basieren auf der aktuellen Fassung der Anlage 2 zum GKG, gültig ab dem 1. Januar 2021. Die einfache Gebühr dient als Grundlage für die Berechnung der Gerichtskosten. Je nach Verfahrensart und Anzahl der Gebühreneinheiten können die tatsächlichen Kosten entsprechend höher ausfallen. ↩︎
- Diese Werte basieren auf der aktuellen Fassung der Anlage 2 zum GKG, gültig ab dem 1. Januar 2021. Die einfache Gebühr dient als Grundlage für die Berechnung der Gerichtskosten. Je nach Verfahrensart und Anzahl der Gebühreneinheiten können die tatsächlichen Kosten entsprechend höher ausfallen. ↩︎