
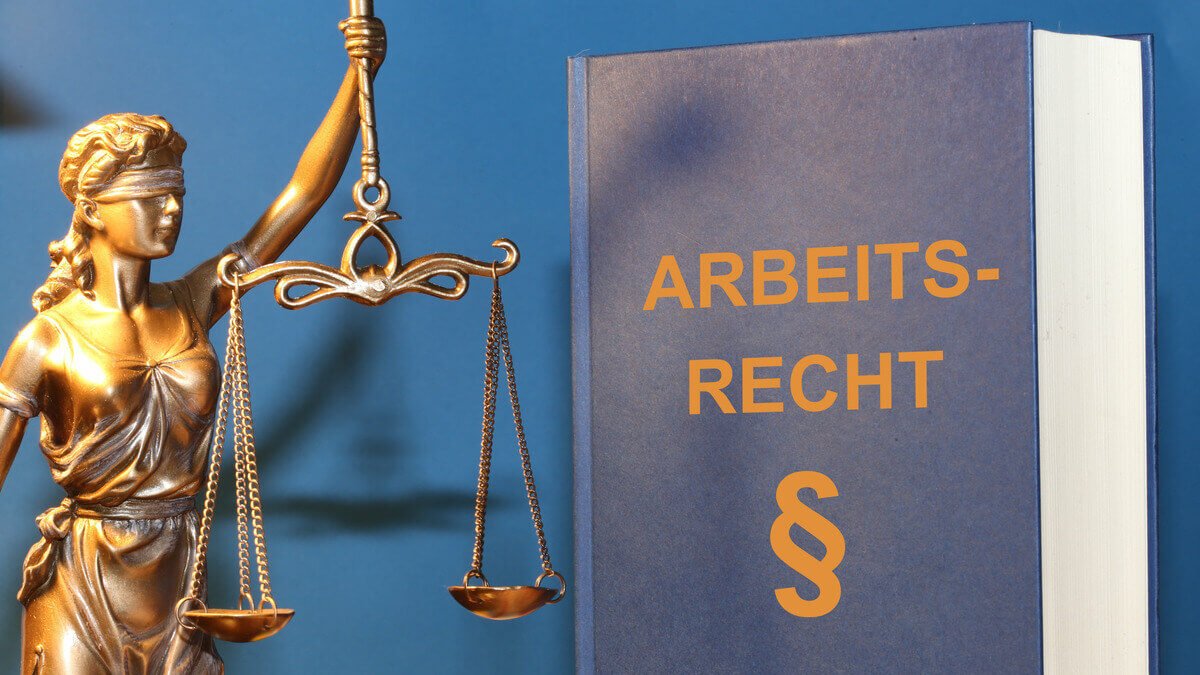
Die Kündigungsschutzklage ist das wichtigste Mittel, mit dem sich Arbeitnehmer gegen unrechtmäßige Kündigungen wehren können. Sie muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der schriftlichen Kündigung beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden. Die meisten Kündigungsschutzklagen werden innerhalb von 1-3 Monaten erledigt. Die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage sind für Arbeitnehmer in der Regel gut. Der folgende Artikel behandelt die Voraussetzungen einer Kündigungsschutzklage, deren Ablauf, die Erfolgschancen (v.a. Höhe der Abfindung bei Kündigungsschutzklage), ob man für die Kündigungsschutzklage immer einen Anwalt benötigt – und welche Kosten zu erwarten sind.
Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden für kostenlose Erstberatung mit Anwalt
Das Wichtigste auf einen Blick:
- In Deutschland werden pro Jahr hunderttausende Kündigungsschutzklagen eingereicht
- Arbeitnehmer müssen innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung eine Kündigungsschutzklage einreichen. Wird diese Frist verpasst, geht der Kündigungsschutz verloren.
- Der Ablauf einer Kündigungsschutzklage ist immer gleich – und die meisten Klagen werden innerhalb von 1-3 Monaten erledigt
- Die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage sind i.d.R. hoch: Nach unserer Schätzung sind mindestens 70-80 % aller Kündigungsschutzklagen für Arbeitnehmer erfolgreich
- Die Wahrscheinlichkeit einer Abfindung ist bei einer Klage deutlich höher als im Durchschnitt der arbeitgeberseitigen Beendigungen. Das rechtfertigt i.d.R. auch die Kosten für einen Anwalt
Inhalte
Kündigungsschutzklage: Allgemeines
Die Kündigungsschutzklage ist ein gerichtliches Verfahren, bei dem ein Arbeitnehmer gegen eine Kündigung durch den Arbeitgeber vorgeht. Sie ist ein wichtiges Instrument zum Schutz von Arbeitnehmern vor ungerechtfertigten Kündigungen. Das Arbeitsgericht prüft dabei, ob die Kündigung gerechtfertigt ist und ob wirklich alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden.
Die Kündigungsschutzklage in Deutschland ist ein völlig normaler Vorgang und keinesfalls ein „feindlicher Akt“. Tatsächlich sollten Arbeitnehmer eine Kündigungsschutzklage einfach deshalb einlegen, weil sonst nach 3 Wochen die gesetzlichen Kündigungsschutzrechte erlöschen. Jedes Jahr werden hunderttausende Klagen vor den Arbeitsgerichten eingelegt und in aller Regel innerhalb von 1-3 Monaten erledigt. Meist durch Vergleich mit einer Abfindung. Die Kündigungsschutzklage hat zwar eigentlich das Ziel, die Kündigung für unwirksam zu erklären und den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses zu sichern. In der Praxis ist das Ergebnis aber fast immer die Zahlung einer Abfindung gegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Berechnen Sie Ihre Abfindungssumme
Jetzt in 2 min für Ihren individuellen Fall Abfindungssumme berechnen!
Kündigungsschutzklage: Voraussetzungen und Ablauf
Inhaltliche Voraussetzung für eine Kündigungsschutzklage ist das Vorliegen einer Kündigung durch den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer muss mit der Klage geltend machen, dass diese Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist. Zusätzlich muss die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist gilt die Kündigung als wirksam – selbst wenn sie ursprünglich rechtswidrig war.
Typische Schritte einer Kündigungsschutzklage
Eine typische Kündigungsschutzklage läuft entlang der folgenden Schritten ab:
1. Rechtliche Bewertung: Zunächst beurteilt der Rechtsanwalt gemeinsam mit seinem Mandanten die Sach- Beweis- und Rechtslage, insbesondere die Wirksamkeit einer Kündigung und die Wahrscheinlichkeit, dass durch eine Kündigungsschutzklage eine (höhere) Abfindung für den Mandanten erzielt werden kann.
2. Einreichen der Klageschrift: Wenn Anwalt und Mandant zum Ergebnis kommen, dass sich das Einlegen einer Kündigungsschutzklage lohnt, wird der Anwalt eine Klageschrift beim Arbeitsgericht einreichen. Diese Klage muss innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der schriftlichen Kündigung beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden. Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist gilt die Kündigung als wirksam.
3. Gütetermin und Verhandlung über Abfindung: Nachdem die Klage durch den Anwalt eingereicht und vom Gericht dem Arbeitgeber zugestellt wurde, kommt es zunächst zu einer sogenannten Güteverhandlung. Wie der Name schon sagt, soll in der Güteverhandlung eine gütliche Einigung zwischen den beiden Parteien herbeigeführt werden. Der Gütetermin ist meist drei bis vier Wochen nach Klageeinreichung. Hier wird meist über einen Vergleich verhandelt, der normalerweise eine Abfindung für den Arbeitnehmer enthält. So kann der Rechtsstreit schnell beendet werden. In mehr als 80% der Kündigungsschutzverfahren gelingt das, so dass der Arbeitnehmer eine Abfindung erhält und das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet wird.
Weitere Schritte (abhängig von Einigungsbereitschaft)
Die folgenden Schritte sind abhängig von der Einigungsbereitschaft der Parteien:
4. Austausch weiterer Schriftsätze und Kammertermin (Optional): In den wenigen Fällen, in denen sich die Parteien im Gütetermin nicht einigen können, geht das Kündigungsschutzverfahren weiter. Das Arbeitsgericht setzt einen neuen Verhandlungstermin fest, den Kammertermin. Dieser Termin ist meist etwa 3 bis 4 Monate später. Oft schreiben die Anwälte in dieser Zeit noch Schriftsätze, um ihre Position zu unterfüttern.
5. Urteil (Optional): Der Kammertermin ist die eigentliche Gerichtsverhandlung. Das Gericht wird erneut versuchen, eine Einigung zu erzielen. Wenn das mangels Einigungsbereitschaft der Parteien nicht gelingt, fällt das Arbeitsgericht eine Entscheidung durch Urteil.
Gegebenenfalls schließen sich Berufung und Revision an, wenn eine Partei das Urteil nicht akzeptieren will. Allerdings gehen nur etwa 3% der Kündigungsschutzverfahren in die zweite Instanz.
Kündigungsschutzklage: Erfolgsaussichten und Abfindung
Die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage sind für Arbeitnehmer in aller Regel hoch – auch wenn dies natürlich immer vom Einzelfall abhängt. Dabei bedeutet Erfolg für den Arbeitnehmer, dass er eine (hohe) Abfindung erhält; das Arbeitsverhältnis wird dabei beendet.
Nach unserer Schätzung sind mindestens 70-80 % aller Kündigungsschutzklagen für den Arbeitnehmer erfolgreich. Die Wahrscheinlichkeit einer Abfindung ist bei einer Klage etwa viermal höher als im Durchschnitt der arbeitgeberseitigen Beendigungen. Durchschnittlich liegen die Abfindungen bei 1,05 Bruttomonatsgehältern pro Beschäftigungsjahr.
Abfindungen fallen umso höher aus, je mehr Gründe es gibt, die für die Unwirksamkeit der Kündigung sprechen können.
Formale Gründe für die Unwirksamkeit der Kündigung
Hier gibt es zum einen formale Gründe, die zur Unwirksamkeit einer Kündigung führen können:
- Schriftform der Kündigung: Kündigungen müssen mit eigenhändiger Unterschrift erfolgen.
- Missverständliche Bezeichnung: Kündigung muss eindeutig als solche erkennbar sein.
- Keine Kündigungsberechtigung: Die Kündigung muss von einer zur Kündigung befugten Person ausgesprochen werden.
- Zugang der Kündigung: Kündigung muss der anderen Partei zugehen, z.B. durch persönliche Übergabe oder Einwurf in den Briefkasten.
- Beteiligung des Betriebsrats: Der Betriebsrat – soweit vorhanden – muss vor jeder Kündigung angehört werden.
- Im Einzelfall auch Nichtangabe von Kündigungsgründen: Kündigungsgründe müssen nur in speziellen Fällen (z. B. Auszubildende, Schwangere) angegeben werden.
- Nichteinhaltung der Kündigungserklärungsfrist: Außerordentliche Kündigung muss innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Kündigungsgrundes erklärt werden.
- Sonderkündigungsschutz: Bei Arbeitnehmern mit besonderem Kündigungsschutz gelten z. T. spezielle Verfahren.
Inhaltliche Gründe für die Unwirksamkeit der Kündigung
Daneben prüft das Arbeitsgericht natürlich auch inhaltliche Gründe:
Im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes sind die Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage gut, da das Gesetz zugunsten der Arbeitnehmer eine umfassende Prüfung der Kündigung durch das Arbeitsgericht vorsieht. Dies bedeutet, dass eine Kündigung nur dann rechtswirksam ist, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. Dabei muss der Arbeitgeber nachweisen, dass die Kündigung entweder aus verhaltensbedingten, personenbedingten oder betriebsbedingten Gründen erfolgt ist, die jeweils die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
Aber auch für Arbeitnehmer, die nicht unter das Kündigungsschutzgesetz fallen, gibt es Schutz vor ungerechtfertigten Kündigungen. So können z.B. Schutzvorschriften für bestimmte Personengruppen wie Schwangere, Eltern in Elternzeit oder Menschen mit Schwerbehinderung eingreifen (besonderer Kündigungsschutz). Hier sind die Chancen auf eine hohe Abfindung (oder Weiterbeschäftigung) besonders groß, weil die Maßstäbe der Rechtsprechung an die Wirksamkeit einer Kündigung sehr streng sind.
Auch bei außerordentlichen (fristlosen) Kündigungen sind die Anforderungen der Gerichte streng. Bei fristloser Kündigung gibt es besonders gute Gründe, Kündigungsschutzklage einzulegen (u.a. drohende Sperrzeit beim Arbeitslosengeld).

Jetzt kostenlos Abfindung berechnen
- Potenzielle Abfindungshöhe berechnen
- Strategie zum Verhandeln einer fairen Abfindung
- Passende Anwälte für Arbeitsrecht finden
Kündigungsschutzklage: Anwalt sinnvoll, aber nicht verpflichtend
Aktuelle Zahlen belegen: Im Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht lassen sich fast alle Arbeitnehmeranwaltlich vertreten. 83% aller Kammertermine auf Arbeitnehmerseite werden von Rechtsanwälten wahrgenommen. Aber der Anwalt ist bei einer Kündigungsschutzklage nicht zwingend. Vor den Arbeitsgerichten besteht keine Verpflichtung, in erster Instanz einen Anwalt zu beauftragen. Theoretisch kann man eine Kündigungsschutzklage ohne Anwalt auch selbst einreichen.
Das spart Anwaltskosten, macht sich aber häufig bei der Abfindungshöhe negativ bemerkbar. Denn ein Anwalt für Arbeitsrecht hat oft jahrelange Verhandlungserfahrung und findet auch versteckte Mängel in einer Kündigung. Für Laien ist es im Einzelfall schwer zu beurteilen, ob und welcher Kündigungsschutz vorliegt. Auch, ob die Kündigung formal unwirksam ist, zum Beispiel weil die “falschen Unterschriften” auf der Kündigung stehen. Der Anwalt klärt auch vorab, ob Ihre Rechtsschutzversicherung die Kosten deckt. Und ist ein erfahrener Verhandler, der “unvorbelastet” in die Verhandlungen geht. Und ganz anders mit Ihrem Arbeitgeber oder seinen Prozessvertretern umspringen kann als ein Arbeitnehmer. Schließlich gibt es noch einen ganz praktischen Grund, warum mit einem Anwalt „mehr rauskommt”. Viele Arbeitgeber sind bei anwaltlich vertretenen Arbeitnehmern eher bereit, eine außergerichtliche Einigung zu vereinbaren. Und das merkt man dann bei der Höhe der Abfindung.
Im Zweifel Expertenwissen nutzen
Letztlich hängt das aber natürlich auch davon ab, wie gut Arbeitnehmer die betriebliche Situation und den Kündigungsgrund darstellen können. In der Regel raten wir aber davon ab, sich „selbst als Anwalt“ bei einer Kündigungsschutzklage zu versuchen. Denn in den meisten Fällen kommt – auch unter Berücksichtigung der Anwaltskosten – mehr raus, wenn man einen erfahrenen Experten an seiner Seite hat.
Kündigungsschutzklage: Kosten
Die Kosten einer Kündigungsschutzklage beinhalten vor allem Gerichts- und Anwaltskosten. Diese müssen getrennt betrachtet werden, auch wenn beide auf dem „Streitwert“ basieren:
- Der Streitwert beträgt in der Regel bei Kündigungsschutzklagen drei Bruttomonatsgehälter. In unserem Artikel zum Streitwert finden sich auch Tabellen zum Streitwert bei Kündigungsschutzklagen und einen Kostenrechner.
- Für die Anwaltskosten im Arbeitsrecht gilt eine besondere Regelung: Der allgemeine Grundsatz „Wer verliert, zahlt“ ist im Arbeitsrecht nur eingeschränkt anwendbar. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung der eigenen Anwaltskosten durch die Gegenseite. Das bedeutet, selbst wenn der Arbeitnehmer den Prozess gewinnt, muss er in der Regel seine eigenen Anwaltskosten selbst tragen. Es sei denn, es wird in einem Vergleich oder einer speziellen Vereinbarung anders geregelt.
- Bei den Gerichtskosten gibt es in erster Instanz vor den Arbeitsgerichten eine weitere Besonderheit. Schließt man dort vor Gericht einen Vergleich, entstehen keine Gerichtskosten
In vielen Fällen übernimmt die Rechtsschutzversicherung die Anwaltskosten, sofern der Arbeitnehmer über eine solche Versicherung verfügt. Für Arbeitnehmer mit geringeren finanziellen Mitteln, die keine Rechtsschutzversicherung haben, gibt es jedoch die Möglichkeit, im Falle einer Kündigungsschutzklage Prozesskostenhilfe zu beantragen. Diese wird gewährt, wenn der Arbeitnehmer nachweisen kann, dass er aufgrund seiner finanziellen Lage nicht in der Lage ist, die Kosten des Verfahrens zu tragen. In diesem Fall übernimmt der Staat die Kosten des Verfahrens, was insbesondere sozial schwächeren Arbeitnehmern eine wichtige Unterstützung bietet.
Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden für kostenlose Erstberatung mit Anwalt
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Welche Frist ist für eine Kündigungsschutzklage zu beachten?
- Kündigungsschutzklage Kosten: So viel zahlen Sie wirklich
- Streitwert bei Kündigungsschutzklage: Infos zur Berechnung des Streitwerts
- Unfair gekündigt? So hilft Ihnen das Kündigungsschutzgesetz
- Kündigungsschutzklage ohne Anwalt: Welche Optionen haben Arbeitnehmer





