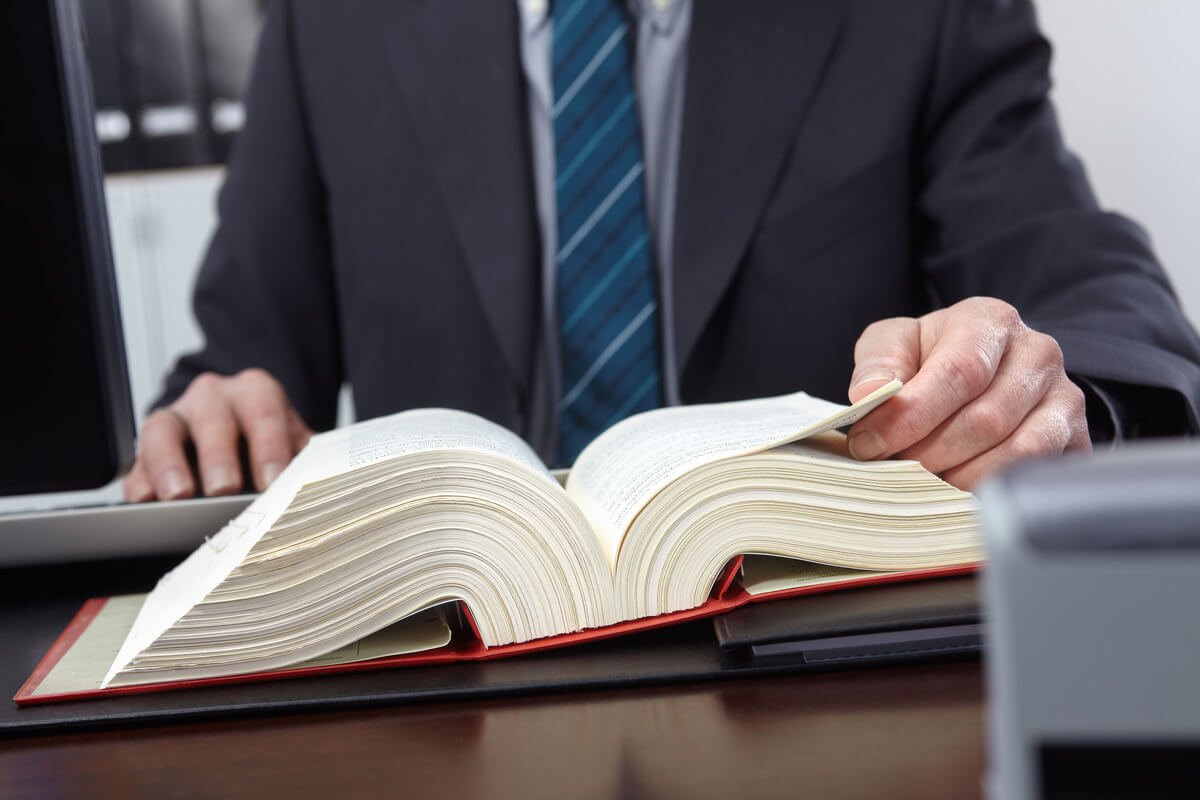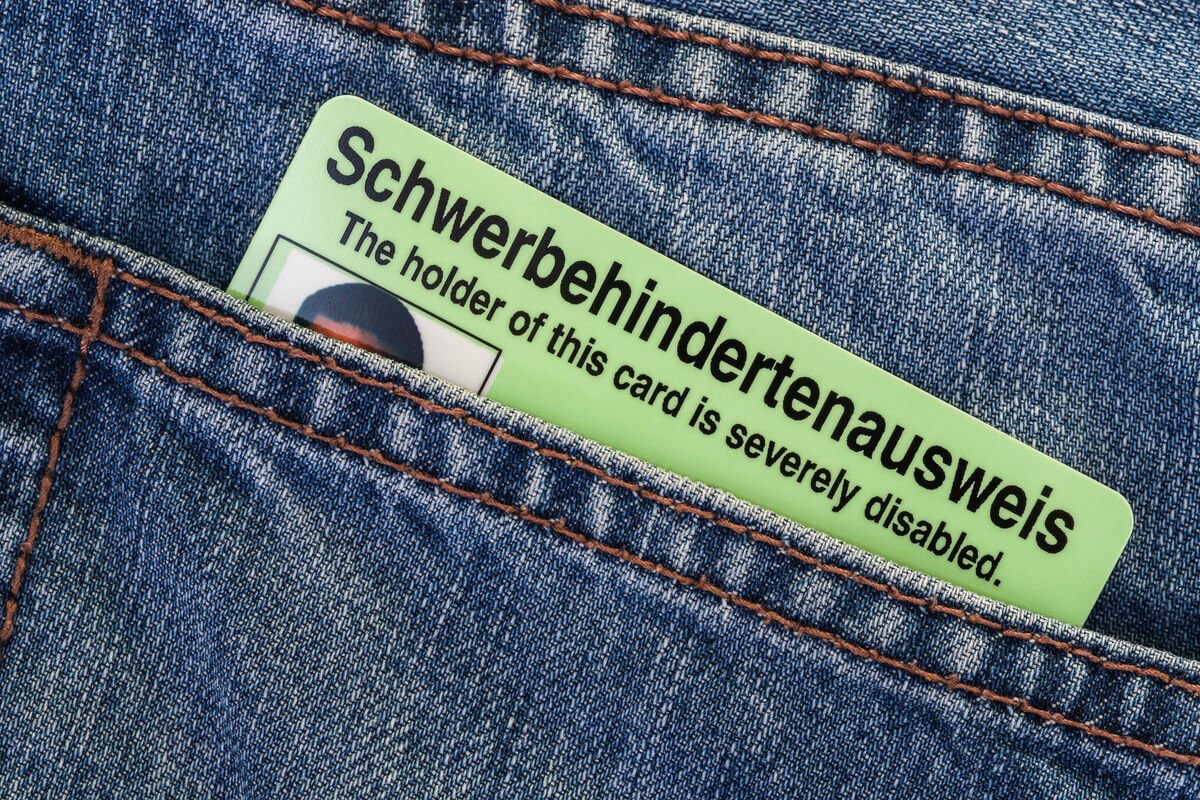Wann beginnt die Arbeitszeit – und was zählt wirklich dazu? Gehören Umkleiden, Dienstreisen oder Pausen dazu? Und wie viele Stunden darf man überhaupt arbeiten? Vieles ist im Arbeitszeitgesetz geregelt: Es schützt Arbeitnehmer vor Überlastung und regelt tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeiten, Pausen, Ruhezeiten sowie Sonn- und Feiertagsarbeit. Dieser Beitrag erklärt, welche Zeiten bezahlt werden müssen, welche Rechte Arbeitnehmer haben und wie sie ihre Arbeitszeit korrekt erfassen.
Berechnen Sie Ihre Abfindungssumme
Jetzt in 2 min für Ihren individuellen Fall Abfindungssumme berechnen!
Das Wichtigste im Überblick:
- Das Arbeitszeitgesetz schützt die Gesundheit von Beschäftigten. Dazu regelt es Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Pausen, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit etc.
- Vertragliche Arbeitszeitregelungen regeln Beginn, Ende, Dauer und Vergütung. Sie dürfen die gesetzlichen Höchstgrenzen aber nicht überschreiten.
- Pausen und Wegezeiten zählen grundsätzlich nicht zur Arbeitszeit, Bereitschaftsdienst und Dienstreisen dagegen schon.
- Überstunden müssen bezahlt oder ausgeglichen werden. Pauschale Abgeltungsklauseln sind häufig unwirksam.
- Arbeitgeber müssen Arbeitszeiten dokumentieren (§ 16 ArbZG). Derzeit wird eine Pflicht zur digitalen Zeiterfassung geplant.
Inhalte
Vertragliche Arbeitszeitregelungen
Es gibt viele Regelungen zur Arbeitszeit und man verliert dabei schnell einmal den Überblick.
Im Wesentlichen gibt es zwei Bereiche. Zunächst gibt es die gesetzlichen Regelungen. Das Wichtigste ist das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Es will die Gesundheit der Arbeitnehmer schützen und regelt deshalb tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeiten, Mindestruhezeiten und Pausen, Nacht-und Schichtarbeit sowie Sonn- und Feiertagsarbeit. Dazu mehr weiter unten.
Zum anderen gibt es die vertraglichen Regelungen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können ihre vertraglichen Arbeitszeiten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im ArbZG frei gestalten. In den meisten Fällen regelt der Arbeitsvertrag den Beginn, das Ende, die Pausen, die Dauer sowie die Vergütung der Arbeitszeit. Findet man im Arbeitsvertrag nicht alles, können sich Arbeitszeitregelungen auch aus Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung (Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat) ergeben.
Der Beginn und das Ende der Arbeitszeit ist meist unproblematisch. Es gibt aber einige Punkte, bei welchen es nicht eindeutig ist, ob sie zur bezahlten Arbeitszeit gehören oder nicht. Hier einige Beispiele:
Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden für kostenlose Erstberatung mit Anwalt
Arbeitsunterbrechungen
Unterbrechungen in der Arbeitszeit, die der Arbeitgeber zu verantworten hat, sind zu vergüten. Beispiele: Maschinenstillstand, Lieferprobleme, Unterbrechungen der Stromversorgung, Brand einer Fabrik, Naturkatastrophen oder behördliche Betriebsschließungen1, die nicht die Allgemeinheit, sondern den konkreten Betrieb betreffen.
Pausen
Pausen dienen alleine der Erholung. Sie zählen nicht zur Arbeitszeit und sind deshalb auch nicht zu vergüten.
Der Arbeitgeber darf die Pausen auch nicht unterbrechen oder den Arbeitnehmer während der Pausen “auf Standby” halten. Dann ist es keine Pause, sondern Arbeitszeit, die zu bezahlen ist.
Wegezeiten
Wegezeiten sind Zeiten vom Wohnsitz des Arbeitnehmers zum Arbeitsplatz und zurück. Sie gehören nicht zur Arbeitszeit. Sie werden nicht vergütet.
Fahrtzeiten eines Außendienstmitarbeiters
Dagegen hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Fahrzeiten eines Außendienstmitarbeiters von seinem Wohnsitz zum ersten Kunden oder vom letzten Kunden nachhause als Arbeitszeit zu vergüten sind.2
Reisezeiten
Reisezeit ist dann als Arbeitszeit zu vergüten, wenn die Reise (1) alleine dem Interesse des Arbeitgebers dient und (2) unmittelbar im Zusammenhang mit der Arbeitsleistung steht. Beispiel: Der Arbeitgeber entsendet einen technischen Mitarbeiter vorübergehend zur Arbeit ins Ausland. Hier sind die für Hin- und Rückreise erforderlichen Zeiten wie Arbeitszeit zu vergüten.3
Bereitschaftsdienst
Bereitschaftsdienst ist die Zeit, in welcher sich ein Arbeitnehmer im Betrieb oder außerhalb des Betriebes aufhalten und jederzeit bereit sein muss, seine Arbeit aufzunehmen. Der Arbeitgeber gibt hier den Aufenthaltsort während des Bereitschaftsdienstes vor. Die Zeit ist deshalb als Arbeitszeit zu vergüten. Wegen der geringeren Arbeitsbelastung kann auch eine geringere Vergütung vereinbart werden.
Rufbereitschaft
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich bei der Rufbereitschaft auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Hier kann sich der Arbeitnehmer den Aufenthaltsort während der Rufbereitschaft aussuchen und dem Arbeitgeber mitteilen. Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, in dieser Zeit auch Freizeitaktivitäten nachzugehen, er muss aber jederzeit erreichbar sein. Das bedeutet: er muss ohne wesentliche zeitliche Verzögerung die Arbeit aufnehmen können. Man geht als Richtwert von einer Stunde aus, jedoch kann dies im Einzelfall auch weniger sein. Oft ist es auch ausdrücklich im Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt. Rufbereitschaft ist Arbeitszeit, die zu bezahlen ist.

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt
- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden
- Strategie zum Verhandeln der Abfindung
Umkleide- und Waschzeiten
Auch Umkleide- und Waschzeiten können als Arbeitszeit vergütet werden, wenn der Arbeitnehmer bestimmte Arbeitskleidung tragen muss und diese nicht bereits auf dem Weg zur Arbeit tragen darf.5 Entsprechendes gilt für erforderliche Waschzeiten.
Gleitzeitregelungen
Gleitzeitregelungen sind im Arbeits-, Tarifvertrag oder meist in Betriebsvereinbarungen geregelt. Hier gibt es zahlreiche Arbeitszeitmodelle. Der Arbeitnehmer kann dies vor Ort beim Betriebsrat oder der Personalabteilung erfragen. Meist gibt es Kernarbeitszeiten, in welchen der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringen muss. Außerhalb der Kernzeiten gibt es flexible Zeitrahmen für Beginn und Ende der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann je nach Arbeitszeitmodell auch die Dauer der Arbeitszeit verändern und an anderen Tagen wieder ausgleichen. Es gibt bestimmte vorgeschriebene Ausgleichszeiträume für Plus- und Minusstunden. Hier sind die konkreten betrieblichen Regelungen entscheidend. Wird der Arbeitnehmer in diesen Zeiträumen gekündigt, verweisen wir auf unsere Beiträge zu Plus– oder Minusstunden nach Kündigung.
Überstunden
Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich nicht verpflichtet, Überstunden zu leisten. Er kann deshalb auf seine vereinbarten Arbeitszeiten bestehen. Aber auch hier können sich andere Regelungen aus dem Arbeits- oder Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung ergeben.
Leistet der Arbeitnehmer Überstunden, sind sie entsprechend als Arbeitszeit zu vergüten. Arbeitsverträge oder Tarifverträge können auch Überstundenzuschläge regeln.
Auch hier enthalten Arbeitsverträge oft Regelungen, nach welchen „Überstunden mit dem Bruttomonatsgehalt abgegolten” sind. Pauschale Abgeltungen sind meist unwirksam. Sie sind nur wirksam, wenn sie klar und verständlich formuliert sind, z. B. wie viele Überstunden sind abgegolten, wann sind Überstunden zu leisten etc. Der Arbeitnehmer sollte sich im Streitfall zu der individuellen Klausel rechtlich beraten lassen.
Verringerung der Arbeitszeit
Arbeitnehmer und Arbeitgeber können auch eine Verringerung der Arbeitszeit vereinbaren. Hierzu erfahren Sie mehr in unserem Beitrag zum Recht auf Teilzeit.
Eine Verringerung der Arbeitszeit kann auch einseitig erfolgen, wenn dies in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung vereinbart wurde (Beispiel: Kurzarbeit)

Jetzt kostenlos Abfindung berechnen
- Potenzielle Abfindungshöhe berechnen
- Strategie zum Verhandeln einer fairen Abfindung
- Passende Anwälte für Arbeitsrecht finden
Gesetzliche Arbeitszeitregelungen
Das Arbeitszeitgesetz will die Gesundheit von Arbeitnehmern schützen, flexible Arbeitszeiten verbessern und vor Sonn- und Feiertagsarbeit schützen.
Das Gesetz erlaubt aber unendlich viele Ausnahmen durch Verordnungen oder Tarifverträge. Im Einzelfall sollte der Arbeitnehmer deshalb immer beim Betriebsrat, Gewerkschaft oder Arbeitsrechtsanwalt nachfragen. Hier die wichtigsten Regelungen im Überblick:
Tägliche Höchstarbeitszeit
Die werktägliche Arbeitszeit eines Arbeitnehmers darf 8 Stunden nicht überschreiten.6
Sie darf ausnahmsweise nur auf bis zu 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden.
Die maximale gesetzliche Tageshöchstarbeitszeit liegt daher bei 10 Stunden plus Pausenzeiten. Tarifverträge dürfen abweichende Regelungen treffen.
Wöchentliche Höchstarbeitszeit
Die wöchentliche Arbeitszeit ist derzeit im ArbZG nicht ausdrücklich geregelt. Sie ergibt sich jedoch aus der täglichen Arbeitszeit von 8 Stunden x 6 Werktage und liegt derzeit bei 48 Stunden. Dies entspricht auch den Vorgaben einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden gemäß den europäischen Vorschriften. Die Pausenzeiten werden hier nicht mit eingerechnet.
Pausen
Das Arbeitszeitgesetz regelt zu Pausen7:
- Pausen zählen nicht zur Arbeitszeit. Sie sind in einem 8 Stundentag nicht beinhaltet.
- Sie müssen im Voraus festgelegt werden.
- Bei einer Arbeitszeit von 6 – 9 Stunden muss eine Mindestpause von 30 Minuten erfolgen.
- Bei über 9 Stunden Arbeitszeit muss die Pause 45 Minuten.
- Die Pausen können in jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden.
- Es darf nicht länger als 6 Stunden hintereinander ohne Ruhepause gearbeitet werden.
Ruhezeiten
Ruhezeiten8 sind nicht zu verwechseln mit Ruhepausen. Es sind die Zeiten, die zwischen der Beendigung der täglichen Arbeitszeit und dem Beginn am nächsten Arbeitstag liegen:
- Der Arbeitnehmer muss eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben.
- In bestimmten Bereichen, wie Krankenhäusern, Pflege etc., können abweichende gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen bestehen.
- Der Arbeitnehmer kann diese besonderen Regelungen beim Personalrat, Betriebsrat oder der Gewerkschaft erfahren.
Sonn- und Feiertagsarbeit
Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich nicht beschäftigt werden.9
Hiervon gibt es aber zahlreiche gesetzliche oder tarifvertragliche Ausnahmen. Dürfen Arbeitnehmer ausnahmsweise beschäftigt werden, müssen mindestens 15 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei bleiben.
Arbeitnehmer erhalten einen Ersatzruhetag innerhalb von zwei Wochen.
Nacht- und Schichtarbeit
Das Arbeitszeitgesetz regelt zur Nacht- und Schichtarbeit10:
- Die werktägliche Arbeitszeit für Nacht- und Schichtarbeit darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann nur auf bis zu 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 4 Wochen im Durchschnitt acht Stunden am Tag nicht überschritten werden.
- Nacht- und Schichtarbeiter sind berechtigt, sich bei Beginn der Beschäftigung und danach innerhalb von 3 Jahren medizinisch untersuchen zu lassen. Die Kosten trägt der Arbeitgeber.
- Nacht- und Schichtarbeiter können eine Versetzung auf einen Tagesarbeitsplatz verlangen, wenn (1) ihre Gesundheit gefährdet ist, (2) ein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt lebt, (3) ein pflegebedürftiger Angehöriger im Haushalt zu versorgen ist. Dabei sind dringende betriebliche Erfordernisse zu berücksichtigen. Der Betriebsrat kann Vorschläge für eine Versetzung machen.
- Arbeitgeber haben dem Nacht- und Schichtarbeiter bezahlte freie Tage oder einen angemessenen Nachtarbeitszuschlag zu gewähren. Das BAG hält einen Zuschlag von 25 % auf das jeweilige Brutto-Stundenentgelt oder die Gewährung entsprechender bezahlter freier Tage für angemessen.11 Dies gilt nur, wenn keine günstigeren tariflichen Regelungen bestehen.

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt
- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden
- Strategie zum Verhandeln der Abfindung
Arbeitszeiterfassung
Arbeitgeber müssen Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit erfassen, inklusive Überstunden und Pausen.12 Der Arbeitgeber kann entscheiden, wie dies geschieht (auf Papier, digital, Stechuhr etc.). Sofern ein Betriebsrat vorhanden ist, hat er mitzubestimmen. Das bedeutet, dass die Regelungen in einer Betriebsvereinbarung festgelegt sind und unmittelbar im Arbeitsverhältnis gelten.
Hat der Arbeitnehmer Fragen, wie er seine Arbeitszeit zu erfassen hat, sollte er dies mit dem Vorgesetzten oder dem Betriebsrat besprechen. Hier sind die betrieblichen Besonderheiten maßgebend.
Die Arbeitszeiterfassung gilt der Kontrolle durch Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Behörden. Verletzt der Arbeitgeber diese Pflichten, kann ihm ein Bußgeld drohen.13
Die neue Koalition plant für 2025/26, dass die Arbeitszeiterfassung digital erfolgen soll. Dabei soll es Übergangsregeln für kleinere und mittlere Unternehmen geben. Wie dies konkret aussehen soll, ist derzeit (Oktober 2025) noch unklar. Die Vertrauensarbeitszeit soll aber ohne Zeiterfassung weiterhin möglich sein.
Arbeitszeitbetrug bei Zeiterfassung
Vergißt ein Arbeitnehmer die Raucherpause auszustempeln oder macht einen falschen Eintrag in der Zeiterfassung, wie z.B. eine zu lange Pause oder vergißt den Eintrag, wann ein Home-Office Meeting geendet hat, so kann das schnell als Arbeitszeitbetrug ausgelegt werden. Für Arbeitnehmer steht dabei einiges auf dem Spiel: Es droht eine Abmahnung, im schlimmsten Fall eine (fristlose) Kündigung oder auch strafrechtliche Konsequenzen. Doch nicht jedes Versehen ist automatisch ein Arbeitszeitbetrug. Oft steckt keine Absicht dahinter, sondern ein Missverständnis, technische Probleme oder unklare Regeln im Betrieb.
Ein Arbeitszeitbetrug liegt nur dann vor, wenn eine bewusste Falschangabe der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit, entweder durch Vortäuschung von Arbeitsstunden oder das Verschweigen von Abwesenheiten während der Arbeitszeit, erfolgt.
Der Arbeitgeber muss den Betrug beweisen. Unzulässige Überwachung (z.B. Software ohne Zustimmung) kann dabei Beweise wertlos machen.
Betroffene sollten solche Vorwürfe unbedingt rechtlich prüfen lassen. Hat der Arbeitgeber Probleme, die Vorwürfe nachzuweisen oder sind sie ganz unbegründet, bestehen auch gute Chancen auf eine Weiterbeschäftigung oder eine Abfindung.
Häufig gestellte Fragen

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt
- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden
- Strategie zum Verhandeln der Abfindung
- BAG 4.05.2022, 5 AZR 366/21 ↩︎
- BAG 18.03.2020, 5 AZR 36/19 ↩︎
- BAG 17.10.2018, 5 AZR 553/17 ↩︎
- BAG 20.04.2011, 5 AZR 200/10 ↩︎
- BAG 19.09. 2012, 5 AZR 678/11 ↩︎
- § 3 ArbZG ↩︎
- § 4 ArbZG ↩︎
- § 5 ArbZG ↩︎
- § 9 ff. ArbZG ↩︎
- § 6 ArbZG ↩︎
- BAG 15.07.2020, 10 AZR 123/19 ↩︎
- BAG 13.09.2022, 1 ABR 22/21: § 16 ArbZG, § 3 ArbSchG ↩︎
- §§ 22, 23 ArbZG ↩︎