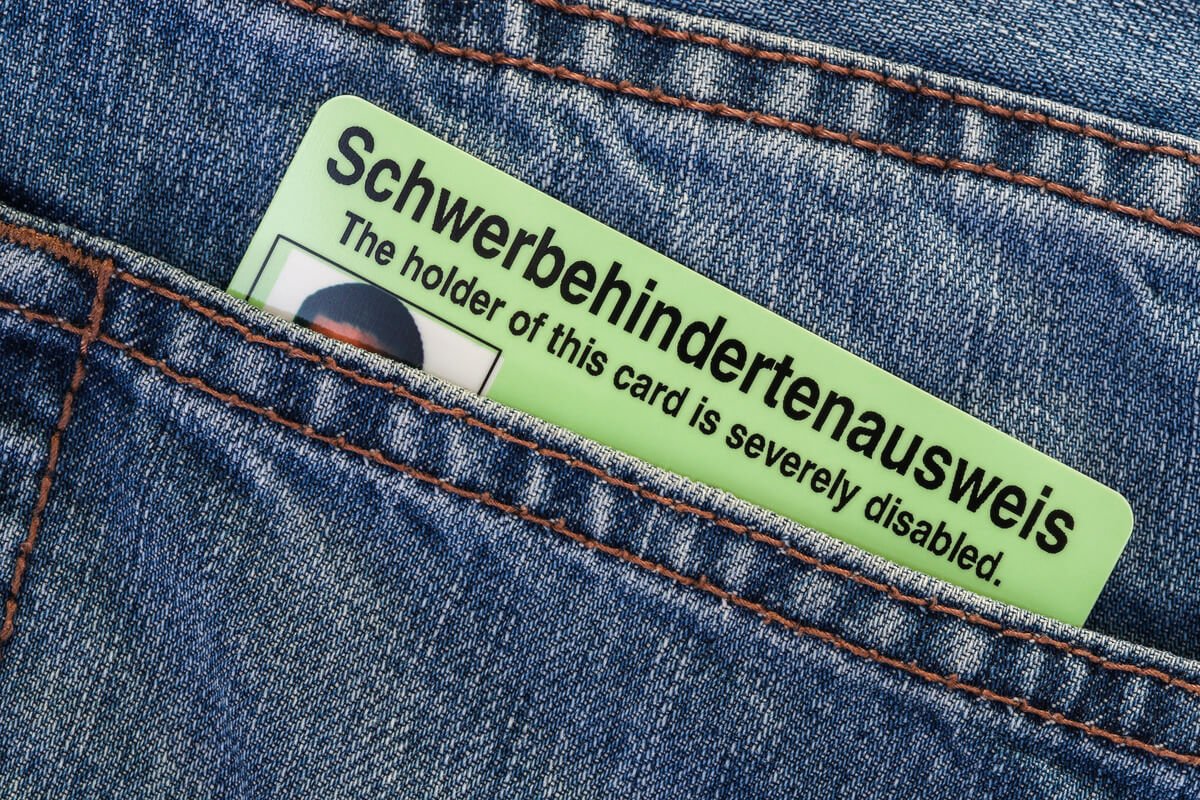Die Kündigungsschutzklage ist das wichtigste Mittel für Arbeitnehmer, sich gegen eine Kündigung zu wehren. Sie muss aber innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung eingereicht werden. Eine nicht fristgerecht angefochtene Kündigung gilt nach Ablauf der Frist als wirksam – selbst wenn sie eigentlich rechtswidrig ist. Eine nachträgliche Klagezulassung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Dieser Artikel erklärt alle wichtigen Aspekte zur Frist der Kündigungsschutzklage für Arbeitnehmer.
Berechnen Sie Ihre Abfindungssumme
Jetzt in 2 min für Ihren individuellen Fall Abfindungssumme berechnen!
Das Wichtigste auf einen Blick:
- Für die Erhebung einer Kündigungsschutzklage gilt eine Frist von 3 Wochen. Die Dreiwochenfrist beginnt am Tag nach dem Zugang der Kündigung.
- Entscheidend ist der Zugang einer schriftlichen Kündigung (also keine mündlichen und elektronischen Kündigungen).
- Eine nicht fristgerecht angefochtene Kündigung gilt automatisch als rechtswirksam – selbst wenn sie eigentlich rechtswidrig ist.
- Eine nachträgliche Klagezulassung kommt nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht.
Inhalt
- Die Dreiwochenfrist zur Einreichung der Kündigungsschutzklage
- Fristberechnung und praktische Beispiele
- Fristbeginn nur mit Zugang einer schriftlichen Kündigung
- Fristbeginn bei Kündigungen mit behördlicher Zustimmung
- Rechtsfolgen einer versäumten Frist
- Ausnahme: Arbeitnehmer kann nachträgliche Zulassung der Klage beantragen
- Praktische Handlungsempfehlungen für Arbeitnehmer
- Häufige Fragen (FAQ)
Die Dreiwochenfrist zur Einreichung der Kündigungsschutzklage
Hat der Arbeitnehmer eine Kündigung erhalten, so kann er gegen diese eine Kündigungsschutzklage erheben. Eine solche Klage muss innerhalb von drei Wochen ab Zugang der Kündigung beim Arbeitsgericht eingereicht werden (§ 4 KSchG).
Die Frist gilt für alle Kündigungsschutzklagen und alle Kündigungsarten – egal ob ordentlich, außerordentlich oder Änderungskündigung. Auch ob man Vollzeit, Teilzeit oder in einer geringfügigen Beschäftigung arbeitet, spielt keine Rolle. Der gesetzliche Kündigungsschutz greift nur bei Einhaltung der Drei-Wochenfrist. Wird die Frist nicht eingehalten, gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam (§ 7 KSchG).
Fristberechnung und praktische Beispiele
Die Berechnung der Frist für die Kündigungsschutzklage folgt klaren Regeln: Die Dreiwochenfrist beginnt am Tag nach dem Zugang der schriftlichen Kündigung (§ 187 BGB). Die Frist endet 3 Wochen später mit dem gleichen Wochentag (§ 188 BGB). Sollte dieser Tag ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sein, verlängert sich die Frist automatisch bis zum nächsten Werktag.
Folgende Beispiele verdeutlichen die Berechnung:
- Fristende Werktag: Erhält ein Arbeitnehmer die Kündigung am Montag, 5. Mai, beginnt die Frist am Dienstag, 6. Mai, und endet mit Ablauf des Montags, 26. Mai (24:00 Uhr).
- Fristende am Samstag/Sonntag: Erhält ein Arbeitnehmer die Kündigung am Samstag, 10. Mai, beginnt die Frist am Sonntag, 11. Mai. Das Fristende wäre der Samstag, 31. Mai (24:00 Uhr). Fällt das Fristende auf einen Samstag oder Sonntag, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag, hier Montag, 2. Juni (24:00 Uhr).
- Fristende Feiertag: Wird die Kündigung am Donnerstag, 10. April, zugestellt, startet die Frist am Freitag, 11. April. Das Fristende wäre Donnerstag, 1. Mai (Tag der Arbeit). Das Fristende verschiebt sich zum nächsten Werktag, hier Freitag, 2. Mai (24:00 Uhr). Hinweis: Bei gesetzlichen Feiertagen ist die Feiertagsregelung des Bundeslandes maßgebend, in welchem die Klage eingereicht werden muss.

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt
- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden
- Strategie zum Verhandeln der Abfindung
Fristbeginn nur mit Zugang einer schriftlichen Kündigung
Zur Berechnung der Dreiwochenfrist ist der Zugang einer schriftlichen Kündigung entscheidend:
- Die Kündigung muss dem Arbeitnehmer zugegangen sein. Der Arbeitgeber hat die Beweislast für den Zugang der Kündigung. Beispiel: Der Arbeitgeber versendet eine schriftliche Kündigung per Post. Die Kündigung geht verloren und kommt beim Arbeitnehmer nie an. Ist die Kündigung nicht zugegangen, wird auch die Dreiwochenfrist nicht in Gang gesetzt.
- Es muss eine schriftliche Kündigung zugegangen sein. Dafür trägt der Arbeitgeber die Beweislast. Mündliche Kündigungen oder Kündigungen per E-Mail, SMS oder Messenger-Dienste sind formunwirksam und setzen die Klagefrist nicht in Gang. Dies gilt auch für Kündigungen per Fax oder als Scan-Dokument, bzw. mit “elektronischer” Unterschrift (z.B. Docusign). Diese sind unwirksam!
Sollten diese Voraussetzungen nicht vorliegen, kann in beiden Fällen der Arbeitnehmer auch noch nach mehr als 3 Wochen Klage erheben. Dies gilt aber nicht für unbegrenzte Zeit. Das Recht zur Klageerhebung kann man „verwirken“ (Verlust eines Rechts). Die Verwirkung setzt voraus, dass zwischen der Kündigung und der Klage ein längerer Zeitraum verstrichen ist (Zeitmoment) und der Arbeitgeber aufgrund bestimmter Umstände annehmen kann, der Arbeitnehmer akzeptiert die Kündigung (Umstandsmoment – dazu unten).
Fristbeginn bei Kündigungen mit behördlicher Zustimmung
Besondere Regelungen für die Fristberechnung der Dreiwochenfrist gelten, soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf.
Der Grundgedanke ist, dass der Arbeitnehmer mit besonderem Kündigungsschutz sich darauf verlassen darf, dass ohne Zustimmung der zuständigen Behörde eine Kündigung nicht wirksam erfolgen kann. Daher sollte er erst mit der Bekanntgabe der behördlichen Entscheidung gezwungen sein, auf eine Kündigung zu reagieren.
Die Dreiwochenfrist beginnt deshalb erst mit Bekanntgabe der behördlichen Entscheidung an den Arbeitnehmer:
- Bei schwerbehinderten Arbeitnehmern ist die Zustimmung des Integrationsamtes erforderlich.
- Während der Schwangerschaft und nach der Entbindung darf eine Kündigung nur in besonderen Fällen von der Behörde für zulässig erklärt werden. Nach der Rechtsprechung gilt jedoch auch hier die Sonderregelung, dass die Dreiwochenfrist erst ab Bekanntgabe der behördlichen Entscheidung beginnt.
- Gleiches gilt bei der Kündigung während der Elternzeit (§ 18 BEEG) und während der Familienpflegezeit (§ 5 Pflegezeitgesetz, § 2 Familienpflegezeitgesetz).
Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden für kostenlose Erstberatung mit Anwalt
Rechtsfolgen einer versäumten Frist
Ist die Dreiwochenfrist versäumt, regelt das Kündigungsschutzgesetz, dass die Kündigung als von Anfang an als rechtswirksam gilt. Dies führt zu mehreren gravierenden Folgen:
- Die wirksame Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der Kündigungsfrist.
- Unwiderruflicher Verlust des Weiterbeschäftigungsanspruchs
- Keine Möglichkeit mehr auf eine Abfindungszahlung
- Keine gerichtliche Überprüfung der Kündigungsgründe
- Verlust des Kündigungsschutzes
Ausnahme: Arbeitnehmer kann nachträgliche Zulassung der Klage beantragen
Hat der Arbeitnehmer die Frist für eine Kündigungsschutzklage (Dreiwochenfrist) verpasst, gibt das Gesetz die Möglichkeit, einen “Antrag auf nachträgliche Zulassung der Klage” zu stellen (§ 5 KSchG). Eine nachträgliche Klagezulassung kommt nur in Betracht, wenn ein Arbeitnehmer “trotz Anwendung aller ihm nach Lage der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert” war, die Klage rechtzeitig zu erheben. Es darf kein Verschulden vorliegen. Der Antrag auf nachträgliche Klagezulassung ist eine Ausnahmeregelung. Die Anforderungen sind sehr hoch und werden in sehr vielen Fällen von den Gerichten abgelehnt.
Beispiele:
- Gesetzlich geregelt ist, dass eine Klage trotz Versäumung der Dreiwochenfrist zugelassen wird, wenn eine Frau von ihrer Schwangerschaft aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund erst nach Ablauf der Dreiwochenfrist Kenntnis erlangt, § 5 Absatz 1 KSchG.
- Alleine die Krankheit eines Arbeitnehmers reicht nicht aus. Sie kann den Antrag auf nachträgliche Zulassung nur dann rechtfertigen, wenn den Arbeitnehmer kein Verschulden trifft. Beispiel: Der Arbeitnehmer war aus medizinischen Gründen verhindert, selbst die Klage zu erheben, weil er die Wohnung nicht verlassen konnte. Und: keine Möglichkeit hatte, Klage durch dritte Personen (Ehegatte, Verwandte, Freunde) einzureichen. Dies hängt immer vom Einzelfall ab, von der Schwere der Erkrankung und den persönlichen Verhältnissen.
- Ein Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt alleine reicht nicht aus, wenn der Arbeitnehmer nicht daran gehindert war, seine Rechte unter Einschaltung dritter Personen wahrzunehmen.
- Während einer Entziehungskur kommt es darauf an, ob dem Arbeitnehmer während der Behandlung Außenkontakte untersagt oder in unzumutbarer Weise erschwert wurden.
- Alleine die urlaubsbedingte Abwesenheit reicht nicht für eine nachträgliche Klagezulassung aus: (1) Geht dem Arbeitnehmer die Kündigung während des Urlaubs im Ausland zu, ist er verpflichtet, elektronische Kommunikationsmittel zu gebrauchen, um eine rechtzeitige Klageeinreichung zu veranlassen. Wartet er damit bis zur Rückkehr, ist die Verspätung verschuldet. (2) Geht das Kündigungsschreiben während des Urlaubs an der Wohnanschrift zu, kommt die nachträgliche Klagezulassung nur in Betracht, wenn der Arbeitnehmer unverschuldet an einer rechtzeitigen Klageerhebung verhindert war. Ein Verschulden wurde bejaht, wenn der Arbeitnehmer für längere Zeit (hier 6 Wochen) abwesend war und seinen Hausbriefkasten aufrechterhalten hat, ohne aber Vorkehrungen für eine zeitnahe Kenntnis dort eingehender Post zu treffen.
Fristen: Der Antrag auf nachträgliche Zulassung muss innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden, spätestens jedoch sechs Monate nach dem ursprünglichen Fristablauf.
Praktische Handlungsempfehlungen für Arbeitnehmer
- Erhalt der Kündigung: Sofort nach Erhalt einer Kündigung sollten Sie das Zugangsdokument und das Zugangsdatum sorgfältig dokumentieren.
- Fristen beachten: Berechnen Sie präzise die dreiwöchige Frist ab dem Folgetag des Zugangs der Kündigung. Diese Frist ist entscheidend für Ihre Handlungsoptionen.
- Anwaltliche Beratung: Wenden Sie sich sofort nach Erhalt der Kündigung an einen Anwalt für Arbeitsrecht. Eine fachkundige rechtliche Beratung ist in dieser Phase unverzichtbar, um Ihre Rechte zu wahren und keine Fristen zu versäumen.
- Klageeinreichung: Ihr Anwalt wird Sie beraten, ob und wie eine Kündigungsschutzklage beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden muss. Beachten Sie, dass die Frist für die Klageeinreichung unbedingt gewahrt werden muss.
- Bei Schwierigkeiten: Informieren Sie umgehend Ihren Rechtsbeistand. Dieser kann Sie bei der Fristwahrung unterstützen.
- Unterlagen sichern: Sammeln und sichern Sie alle relevanten Unterlagen, wie z.B. die Kündigung, Korrespondenzen und Zeugenaussagen, die Ihre Ansprüche untermauern könnten.
- Rechtsschutzversicherung prüfen: Überprüfen Sie, ob Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, die die Kosten für eine Kündigungsschutzklage übernimmt.
Die Einhaltung der Frist für die Kündigungsschutzklage ist für den Erfolg einer Kündigungsschutzklage von zentraler Bedeutung. Lassen Sie sich nicht auf das Risiko ein, diese Frist zu verpassen. Suchen Sie daher frühzeitig anwaltliche Unterstützung, um Ihre rechtlichen Optionen zu prüfen und durchzusetzen. Nur so können Sie Ihre Rechte effektiv schützen und sich gegen unrechtmäßige Kündigungen wehren.

Jetzt kostenlos Abfindung berechnen
- Potenzielle Abfindungshöhe berechnen
- Strategie zum Verhandeln einer fairen Abfindung
- Passende Anwälte für Arbeitsrecht finden
Häufige Fragen (FAQ)

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt
- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt
- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden
- Strategie zum Verhandeln der Abfindung
- Unfair gekündigt? So hilft Ihnen das Kündigungsschutzgesetz
- Kündigungsschutzklage: Ein Mittel gegen ungerechtfertigte Kündigungen
- Kündigungsschutz: Welche Bedingungen gelten in Deutschland?
- Besonderer Kündigungsschutz: Was gilt es zu beachten?
- Kündigungsschutzklage Kosten: So viel zahlen Sie wirklich
- Streitwert bei Kündigungsschutzklage: Infos zur Berechnung des Streitwerts
- Prozessarbeitsverhältnis: Arbeiten während einer Kündigungsschutzklage
- Kündigung im öffentlichen Dienst: Fristen, Kündigungsschutz, Abfindung
- Kündigungsschutz in Kleinbetrieben mit maximal 10 Mitarbeitern